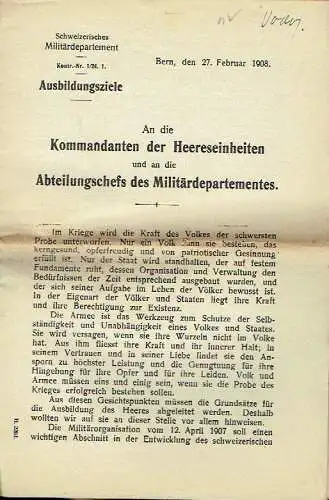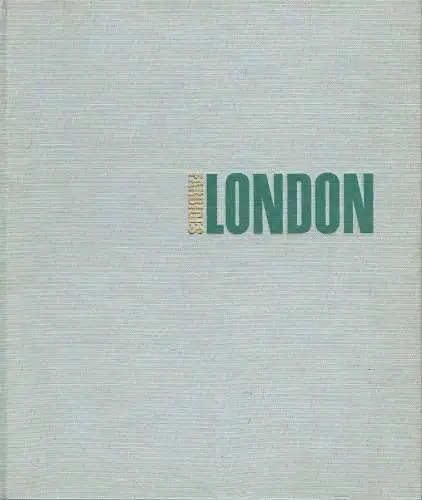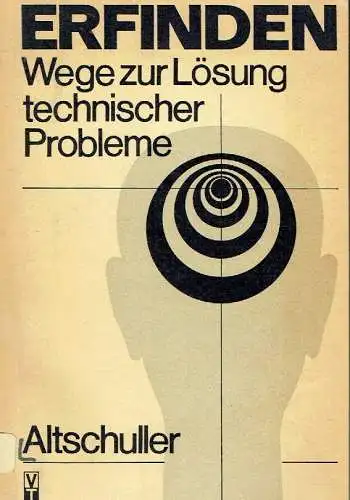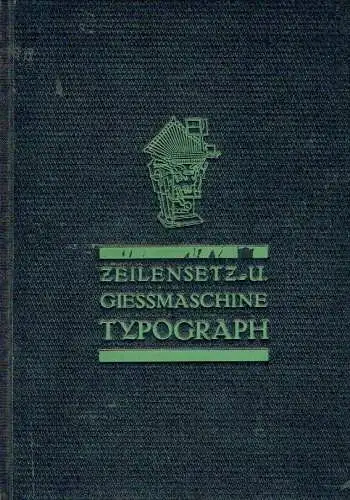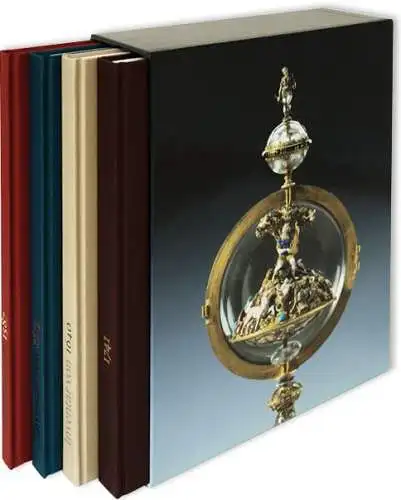Statut
guter Zustand, geringe Gebrauchs- und Alterungsspuren: Deckel etwas verzogen / leicht gewölbt - Vorsätze gebräunt - Seiten sauber und ordentlich - Schutzumschlag defekt (vorn links oben größere Fehlstelle, Rückseite rechts unten mit kleiner Fehlstelle), Die Gangsterbande "Unter der großen Eiche hatten sie ihr Stammlokal. Ihre Hüte waren olivgrün, wenn auch die Individualisten unter ihnen mehr einen Stich ins Blaßgrüne bis Weißliche bevorzugten. Einige hatten auch einen bräunlichen Ton als Dernier cri gewählt. Sonst aber hielten sie auf standesgemäße Kleidung, wobei es vor allem Sitte war, die Manschette mit lässiger Nonchalance am schlanken, weißen Stiel zu tragen. Eine dezente, zickzackartige Maserung auf dem Stiel galt als besonders vornehm. Das Wichtigste aber war die lappige Hauttasche am dicken, knolligen Stielgrund ‒ wer die nicht hatte, galt nicht als würdig, ihrer »Gang« anzugehören ! Ab Juli waren sie »voll am Ball«, wie es in ihrer Ganovensprache hieß. Und wehe dem Ahnungslosen, dem nur einer von ihnen in den Pilzkorb beziehungsweise in den Kochtopf rutschte! Um dieses Thema drehten sich ihre Lieblingsgespräche bei allen Treffs. »Letztens«, hob der Chef der Bande an, der sich mit zunehmendem Alter gern mit dem Odeur eines leichten Parfüms umgab, dessen Duft an Kunsthonig erinnerte, »letztens hatte sich Knollen-Ede bei ihnen eingeschmuggelt. Wollten ihm mit gehacktem Kaninchenmagen zu Leibe. Hat ihnen aber wenig genutzt!« »Und Manschetten-Orje wollten sie gar mit Alkohol kirre kriegen!« amüsierte sich ein anderer. »Na, der hat gejubelt! Das war genau das, was unsereins so braucht, um erst richtig Kobolz zu schlagen!« »Det dufte an der Schose is ja«, ergänzte Zick-Zack-Bubi, dessen Jargon man es unverkennbar anmerkte, daß er aus der näheren Umgebung Berlins stammte, »det dufte is ja also, möcht' ick ma sprechen, det die Brüder erst nach Stünden merken, wat eijentlich los is, wa? Aber da ham wa uns ja längst int Blut vakrümelt ‒ und da soll so'n liebes Onkel Doktorchen erst mal wat machen!« Nachdem so ziemlich alles versammelt und die Bande beschlußfähig war, wurde über die Aufnahme ihrer Stammesbrüder, der gelben und der kegeligen Knollenblätterpilze, in ihren Verein beraten. Bezüglich der kegeligen herrschte allgemeine Einstimmigkeit. Zwar meinte man, daß sie es sich abgewöhnen könnten, ein so verräterisches Weiß zu tragen und selbst in reiferem Alter noch diese alberne, stumpfkegelige Hutform beizubehalten. Da aber an der Wirksamkeit der von ihnen bevorzugten Gifte nicht zu zweifeln war, erhob sich keine Gegenstimme. Anders verhielt sich die Sache schon bei den gelben. »Empfehlen möchte ich sie ja keinem!« fuhr der Boß mit hämischem Grinsen fort, fügte dann aber mit wegwerfender Handbewegung hinzu: »Den Beweis allerdings, daß sie jemanden um die Ecke bringen können, sind uns diese Brüder bis heute schuldig!« Nächster Tagesordnungspunkt war das Verhalten gegenüber den Konkurrenzunternehmen. Als erstes knöpfte man sich die »Vereinigung der Faserköpfe« vor, wobei man sein besonderes Augenmerk auf den Mairißpilz lenkte. Die Meinungen waren geteilt. »Verteufelte Burschen! Vor allem sind sie uns jedes Jahr um zwei Monate voraus!« erklärten die einen. »Du lieber Gott, wer fällt auf die schon rein!« entgegneten die anderen. Die Versammlungsleitung gebot Schweigen. »Wir müssen die Lage real einschätzen, Kollegen! Wir wissen doch, auf welche raffinierte Masche diese Brüder reisen! Halten sich einfach zwischen den Mairitterlingen auf und tun, als ob sie kein Wässerchen trüben könnten! Weiß sind sie obendrein auch noch, wenn sie auch im Gegensatz zu diesen altmodische, ausgefranste Hüte tragen und mit zunehmendem Alter in hektischen Flecken rot anlaufen, als ob sie vom Kopf bis zum Stiel die Masern hätten!" »Vielleicht erzählen sie sich schlechte Witze« warf ein vorlauter narzissengelber Wulstling ein, der im Kreis echter Ganoven eigentlich nur geduldet war, da sein Gift kaum einem Schoßhund was anhaben konnte und der außerdem noch die Manschette aus stillem Protest gegen den Konservativismus (wie er die erhabenen Traditionen zu betiteln pflegte) stets in unordentlichem, meist sogar zerrissenem Zustand trug. »Lassen wir das! Fest steht jedenfalls, daß die Burschen ihr Handwerk aus dem Effeff verstehen und schon so manchen auf dem Kerbholz haben! Also, was tun wir? Kommen wir zur Diskussion!« Wie meist in solchen Fällen, herrschte erst einmal betretenes Schweigen, da keiner den Anfang machen wollte. Darin machen auch Knollenblätterpilze keine Ausnahme! Schließlich erwies sich ein kaum der Hauttasche entwachsener Jüngling als »Eisbrecher«, der schon mal eine Lappe riskieren durfte, da er auf einen hervorragenden Stammbaum mit alten Traditionen zurückblicken konnte. ‒ Einem seiner Vorfahren war es doch wirklich gelungen, gleich nach dem Aussporen ein paar ahnungslosen Städtern vorzugaukeln, daß es sich bei ihm um einen Waldchampignon handele. Natürlich war ihm deren törichte Ansicht, auf der Wiese seien Champignons (wie sich die Egerlinge in ihrer Arroganz mit französischem Namen nannten) eben weiß, demzufolge seien die im Walde weniger ausgeblichen und eben grün, sehr entgegengekommen. Ein nur halbwegs Erfahrener hätte ihm diesen Blödsinn schon auf Grund seiner weißen Lamellen nicht abgekauft; aber sein Ruhm blieb dessenungeachtet ungeschmälert! ‒ Besagter Sproß jener erfolgreichen Familie schob also noch einmal die Manschette zurecht und begann: »Ganz abgesehen davon, daß ‒ äh ‒ unsere Vorrangstellung unter den Giftpilzen ganz unbestritten sein dürfte, bin ich doch der Meinung, ja, der festen Überzeugung, daß wir ‒ äh ‒ in unserem zähen Existenzkampf gegen die zumindest quantitative Überlegenheit genießbarer Sorten (anhaltende Pfui-Rufe!) bei der Betrachtung der uns Gleichgesinnten ‒ äh ‒ mehr das Für- als das Gegeneinander erwägen sollten!« Anhaltender Beifall von der Flanke der als Beobachterdelegation anwesenden Pantherpilze, die den hierorts Versammelten in puncto Giftigkeit kaum nachstanden und deren Haupttrick es war, sich mit dem Perlpilz verwechseln zu lassen ...", Leinen, ca. 16,5 x 23,5, 76 Seiten und 12 Farbtafeln mit Illustrationen